Man muss lange suchen, um einen Schriftsteller zu finden, der so tief ins Leben gesprungen ist wie Ernest Hemingway. Alles übermässig und alles ungebremst. Ohne Rücksicht auf Verluste. Bei sich und anderen. An Körper und Seele.
Das Leben, die Liebe und das Sterben. Geburt und Tod. Dazwischen die Leidenschaft. Damit ist der Bogen des Lebens gezogen. Und auch der Bogen von Hemingways Leben. Und alles – das ist die Tragik des Menschen – scheint miteinander verwoben. Leben und Liebe, Leben und Tod, Liebe und Tod.
Der Tod gehört zum Leben. Und er gehört ins Leben. In einfachen Sätzen beschreibt Ernest Hemingway diese Tragik des menschlichen Daseins. Und das Motiv von Leben und Tod zieht sich in Abwandlungen durch das ganze Werk Hemingways fort.
Er trage seinen Tod auf der Schulter, hat José Luis Castillo-Puche, ein spanischer Kollege und Freund, in Madrid 1954 zu Ernest Hemingway gesagt. Dieses spanische Sprichwort trifft es besser als alles andere. Una vida con la muerte al hombro.
Warum habe ich so viele Tiere getötet, fragt der passionierte Jäger Hemingway seinen Schwarm Ava Gardner, die Hollywood-Schönheit. Vielleicht war es nicht richtig, die Tiere zu töten. Aber wenn ich sie nicht getötet hätte, hätte ich mich wahrscheinlich selber getötet.
Das Schreiben als Notwehr, als eine Akt, dem Tod eins auszuwischen? Mag sein. Doch was ist, wenn die Schreibmaschine eingerostet ist? Was bleibt einem Mann dann noch?
Der Alkohol? Sicher, Alkohol tötet die bösen Riesen. Die Depression, die Einsamkeit, den Selbsthaß und die Angst. Doch tötet Whiskey auch den größten Riesen?
Die Liebe? Richtig, die Liebe bleibt. Die richtige und die wahre Liebe. Vielleicht ist die Liebe stärker als alle Riesen. Daran gibt es keinen Zweifel.
Ansonsten bleibt nicht viel. Die Liste ist abgearbeitet. Die Perspektive klar. Und dann stellt sich die letzte Frage. Wer soll über das Ende entscheiden? Der Weißkittel, die Ehefrau, die Paragraphen?
Den letzten Sieg soll nicht er davon tragen, der Schatten auf der Schulter. Er will den letzten Pfahl einrammen, nur er, sonst keiner. Unser Schicksal ist, zu verlieren. Aber wir sollten nach unseren eigenen Spielregeln verlieren. Etwas anderes bleibt uns auch nicht, seit wir aus dem Garten Eden vertrieben wurden.
Solch eine Welt, in der nur ein Dackel glücklich zu sein vermag, kann nicht gerecht sein. Die Welt tötet die sehr Guten und die sehr Feinen und die sehr Mutigen. Ohne Unterschied. Hemingways Helden ticken wie Hemingway. Eigentlich sind es keine richtigen Helden, mehr Anti-Helden, die versuchen, ihrer eigenen Unzulänglichkeit Herr zu werden. Die versuchen, ihr Scheitern an Anspruch und Leben und Liebe in den Griff zu bekommen. Und trotzdem scheitern.
![]()


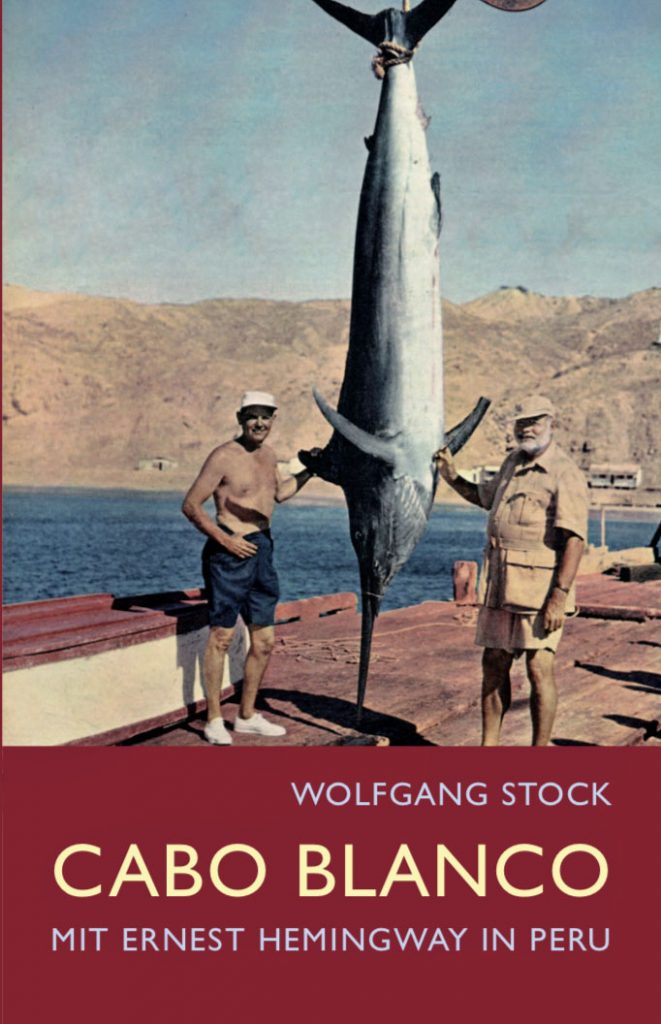
Schreibe einen Kommentar