
Es bleibt eine seltsame Welt für Ernest Hemingway, ungewohnt sicherlich, aber nicht ohne Reiz. Old Constant lautet die Überschrift eines der schönsten Artikel im The Toronto Daily Star, er wird am 28. Oktober 1922 in der kanadischen Tageszeitung veröffentlicht: Wenn Sie am Morgen aufwachen und über dem Goldenen Horn einen Nebel sehen, aus dem die Minarette schmal und glatt zur Sonne hochwachsen und der Muezzin die Gläubigen zum Gebet ruft, in einer Stimme, die sich hebt und senkt wie die Arie einer russischen Oper, dann begrüßt Sie die Magie des Ostens.
Der türkische Name für das Goldene Horn lautet Haliç, was schlicht Mündung bedeutet. Die Bezeichnung führt sich zurück auf den goldenen Glanz, der sich in der Abendsonne über das Wasserbett legt. Doch das Goldene Horn ist mehr als ein sieben Kilometer langer Meeresarm, der wie ein Horn in gebogener Form dem Bosporus zufließt. Das Gewässer vor Istanbul symbolisiert den Reichtum und die Pracht des byzantinischen und osmanischen Konstantinopels.

Der sieben Kilometer lange Wasserarm, Goldenes Horn genannt, liegt auf der europäischen Seite des Bosporus, kurz vor dessen Ausgang in das Marmarameer. Foto: W. Stock, Februar 2020
Am Goldenen Horn schlägt das Herz dieser Metropole, denn bei den einfachen Handwerkern, den kleinen Händlern und in den Restaurants am Flussufer lässt sich der Pulsschlag dieser Stadt messen. Ob es der Nation gelingt, obenauf zu sein oder vom Mahlstrom der Politik ins Desaster gezogen zu werden, man kann es an der Betriebsamkeit zu beiden Seiten des Goldenen Horns besser ablesen als in den Aktienspalten der Wirtschaftszeitungen.
Auch Ernest Hemingway wird überwältigt von der Stadt zwischen Europa und Asien, im Guten wie im Schlechten. Die staubigen Strassen, der Schlamm, die Lautstärke, die Straßenhunde, die Ratten. Alles kommt ihm merkwürdig bis chaotisch vor, beklagt er sich in seinen Depeschen. Der Verkehr, die Straßen, das Essen, alles unvertraut. Konstantinopel, das erst seit 1930 Istanbul heißt, wird als Sündenpfuhl dargestellt, der Dekadenz anheimgefallen. Konstantinopel führt eine Art Todestanz auf, bevor Kemal Pascha kommt, der geschworen hat mit all den Sauftouren, Glücksspiel, Tanzen und Nachtklubs kurzen Prozess zu machen.
Der junge US-Amerikaner betrachtet die Welt des Orients mit seinen Augen. Was in der Heimat gut funktioniert, stösst in der Fremde an seine Grenzen. Vielleicht, um Kant etwas abzuwandeln, weil es das Gute an sich nicht gibt, bestenfalls das Gute für sich. Und so bleibt dem bodenständigen Schreiber aus Amerika nichts weiter übrig, als in der Kuriositätenkiste dieser Stadt zu wühlen.

Die Yeni Cami aus dem Jahr 1663, zu Deutsch Neue Moschee, befindet sich im Stadtteil Eminönü, in der Nähe des Gewürzbasars, am südlichen Ende des Goldenen Horns. Foto: W. Stock, Februar 2020.
Als aufgekratzter Melting Pot der islamischen, jüdischen und christlichen Kultur kommt diese Metropole daher. Es gibt 160 gesetzliche Feiertage in Konstantinopel. Jeder Freitag ist ein muslimischer Feiertag, jeden Samstag ein jüdischer Feiertag und jeder Sonntag ein christlicher Feiertag. Dazu finden sich katholische, muslimische und griechische Feiertage innerhalb der Woche, von Yom Kippur und anderen jüdischen Feiertagen gar nicht zu reden. Kein Wunder, das Lebensziel eines jeden jungen Menschen in Konstantinopel ist, in einer Bank zu arbeiten.
Nicht überraschend erschließt sich diese Stadt dem Mann aus dem Mittleren Westen der USA nur sehr schwer. Für einen 23-Jährigen, der aus dem gut situierten Idyll der Vorstädte Chicagos kommt, muss die Begegnung mit dem Orient ein Kulturschock gewesen sein. Paris ist auch die Fremde für ihn, aber eine Fremde, die er immer erträumt und vermisst hat. Konstantinopel hingegen verklärt sich bei Hemingway poetisch als die Magie des Ostens.
Zwei Momente jedoch trösten ihn. Die Tatsache, dass nach der dunklen Nacht ein neuer heller Morgen aufgeht. Und auch der Ruf des Muezzins zum Gebet baut ihn auf. Ernest Hemingway, der sonst mit dem religiösen Dogma nicht viel am Hut hat, entdeckt den Zauber einer Stadt unterschwellig über die lokalen Glaubensrituale. Seine Poesie hilft ihm selbst am meisten, das überall sichtbare Leid auszuhalten und den Liebreiz Konstantinopels an sich heranzulassen.
Es deutet sich bei diesem kernigen Mann ein Lebensmuster an: Die Riten der Religion dienen als Anker für die Seele in Not. Ein Grund, weshalb er Spanien so sehr liebt. In den guten Tagen macht er sich über den Glauben lustig, in der Bedrängnis sucht er auf seine Weise Zuspruch. So verwundert es nicht, dass Ernest Hemingway – am Ende einer langen literarischen Durststrecke – eine wunderbare Erzählung über einen alten Mann und den Fisch zu Papier bringt. Eine Erzählung von alttestamentarischer Wucht, mit Dutzenden von Anspielungen an religiöse Topoi.
Als Gegenspiel zur lärmenden Nacht lässt Ernest Hemingway den Prediger das Licht des Tages und der Zuversicht ausrufen. Der junge Journalist wiederholt sein Motiv im gleichen Artikel zum Ausklang noch einmal. Das Lachen der Betrunkenen und der schwarze schlüpfrige Muff der mit Abfall übersäten Straßen von Konstantinopel stehen im Gegensatz zum schönen, gedämpften, aufsteigenden Singsang des Muezzins, der am frühen Morgen zum Gebet ruft und dann findet man sich wirklich wieder in der Magie des Ostens.
![]()

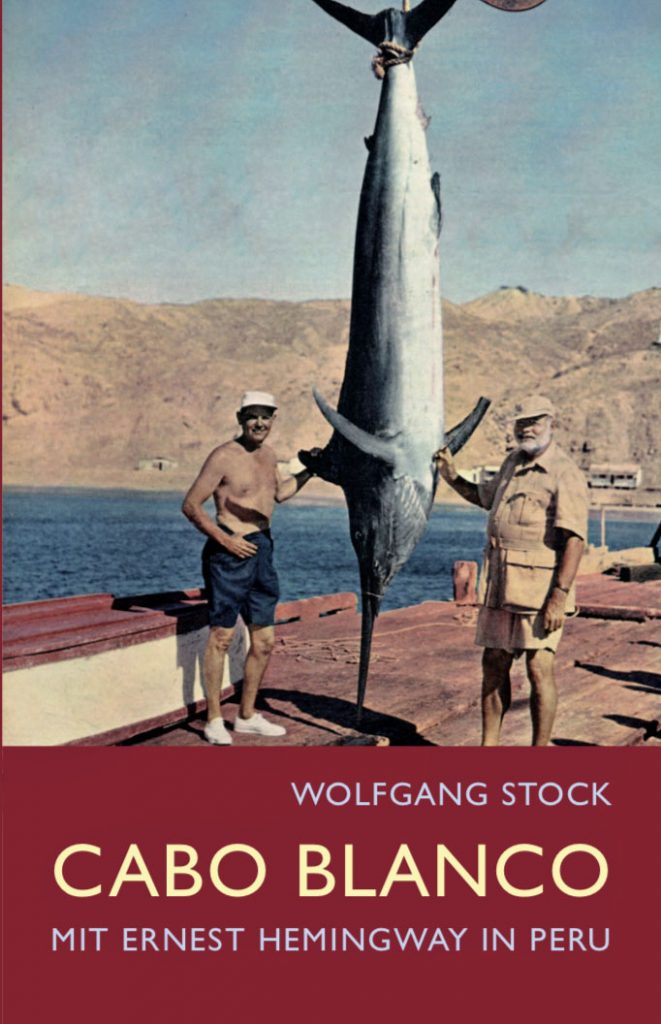
Schreibe einen Kommentar