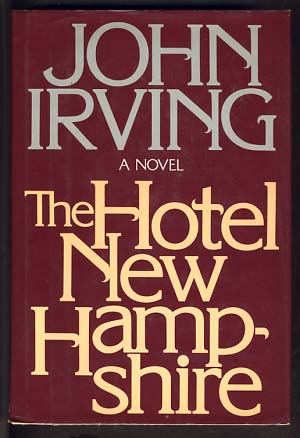
Ernest Hemingway ist noch heute quicklebendig, seine Werke werden in den Buchhandlungen geführt, er wird – fast sechs Jahrzehnte nach seinem Tod – millionenfach gelesen und von vielen bewundert. Jeder kennt mindestens eines seiner Werke, man weiß um sein aufregendes Leben. Kurz, Ernest Hemingway ist bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund.
Doch so mancher seiner Kollegen betrachtet den bärtigen modernen Klassiker aus Chicago – literarisch wie menschlich – mit argem Stirnrunzeln. Direkt nach Ernest Hemingway ist eine neue Autorengeneration herangewachsen, John Updike, Arthur Miller, Norman Mailer, Joseph Heller – eine Generation, die sich vom Vater absetzen muss, und vieles anders sieht.
Die Gegensätze können nicht größer sein. Die Großstadt-Schreiber gefallen sich als Trüffelschnüffler der modernen amerikanischen Mittelklasse. Der alte Hemingway hat das Geplauder des intellektuellen Mainstreams nie gemocht, zu viele Ehedramen, Beziehungskonflikte und Berufsprobleme, das alles ist nicht seine Welt. Ernest Hemingway, der Weltenbummler und Großwildjäger, kann mit der literarischen Selbsterkundung der Großstadtneurotiker nichts anfangen.
Die Abneigung beruht auf Gegenseitigkeit. „Hemingway habe ich immer verachtet“, keilt beispielsweise John Irving, der US-amerikanische Schriftsteller aus New Hampshire, Jahrgang 1942. „Ich habe mich für ihn geschämt, als Mann und Autor. Seine Art und Weise, das Maskuline zu repräsentieren ist ein Witz. Er war kein Boxer, er war ein Alkoholiker, ein überschätzter Trinker, der überdies verantwortlich war für die literarische Welle all seiner Nachahmer. Mir gefallen die langen Sätze und die vielschichtigen Charakteren – aber das Tiefste das Hemingway erreichte, bestand darin, eine Charaktere zu erschaffen, die keinen hochkriegte. Deshalb ist Hemingway der größte Hochstapler der Geschichte. Als Mann und als Schriftsteller.“
Ernest Hemingway, ein Hochstapler? Solch ein Vorwurf ist unredlich, denn seine Qualität hat ganze Autorengenerationen beeinflusst und geprägt, so oder so. Truman Capote, Norman Mailer – ohne Ernest Hemingway nicht vorstellbar. Malcolm Lowry, ein undomestizierter Kerl und wilder Schreiber wie er, hat sich mit 47, im Jahr 1957 tot gesoffen und mit Pillen ins Jenseits befördert, Paul Theroux, einer der Braven aus der Hemingway-Schule. Nelson Algren, aus Papas harter Schule, Bruce Chatwin, ein Abenteurer wie er, und auch der Kolumbianer Gabriel García Márquez ist ein Mann, der seinen Hemingway gründlich studiert hat. Die Liste muss unvollständig sein, weil sie viel zu lang ist.
Die Generation der Söhne sieht ihn mitunter kritisch, die Enkel hingegen urteilen milder. Im Gegenteil, die Generation der Enkel rückt dem Opa Hemingway wieder ganz nahe und probt mit dem New Journalism die Kulturrevolution in den Redaktionsstuben. Subjektivität statt Objektivität, Nähe statt Distanz. Rrrumms statt Analyse. Der Leser muss aus den Zeilen den Duft riechen, die Farben sehen und den Rabatz hören können.
Der New Journalism trägt mit der Authentizität seiner Beobachtung und seiner subjektiven Weltläufigkeit die stilistischen Grundregeln des Ernest Hemingway in die moderne Zeit. Der einzigartige Hunter S. Thompson, ein tiefer Verehrer Hemingways, schreibt für den Rolling Stone, Gay Talese und Tom Wolfe für Esquire. Michael Herr berichtet aus dem Vietnam-Krieg. Viele aus der Enkel-Generation sehen die Väter überaus kritisch und schwärmen wiederum vom Großvater.
Wie auch immer, Ernest Hemingway hat sie alle überlebt. Die Söhne und die Enkel. Noch heute hört man hier und dort leise Kritik. Er sei zu laut, zu maskulin, schreibe nur für Männer, die armen Tiere, die er grundlos abschlachte, die vielen Affären, sein Leben, der Selbstmord. Es kommt so einiges zusammen bei diesem Mann. Man kann ihn kritisch sehen, man darf sich an ihm reiben. Nur eines passiert eben nicht: Dass dieser Ernest Hemingway einen gleichgültig lässt.
![]()

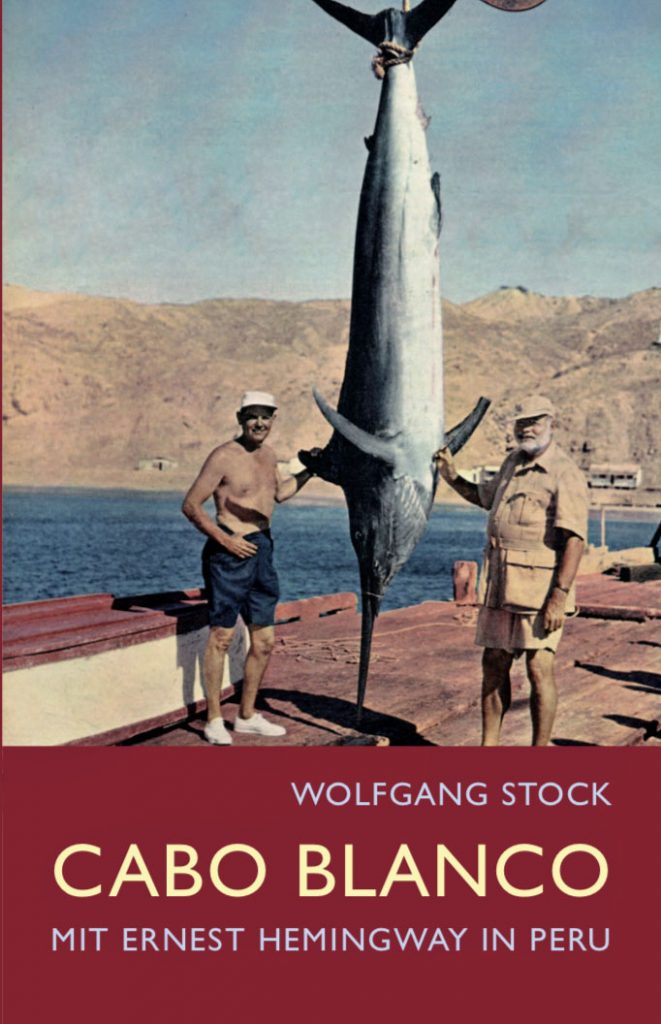
Schreibe einen Kommentar