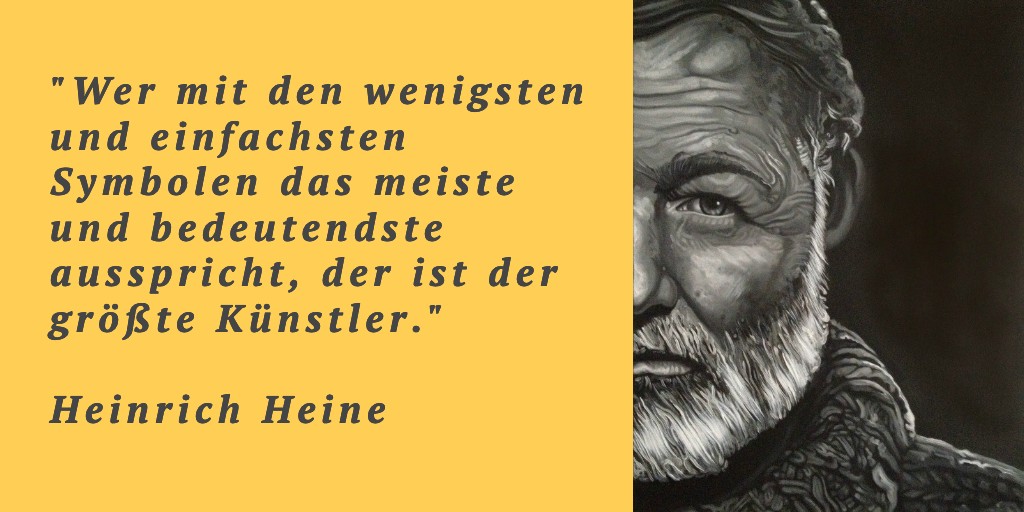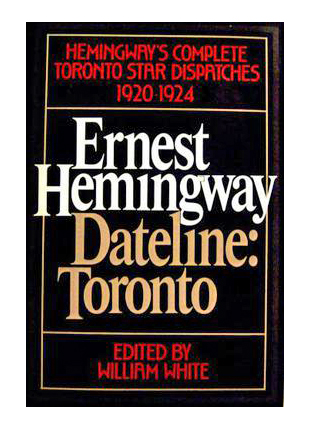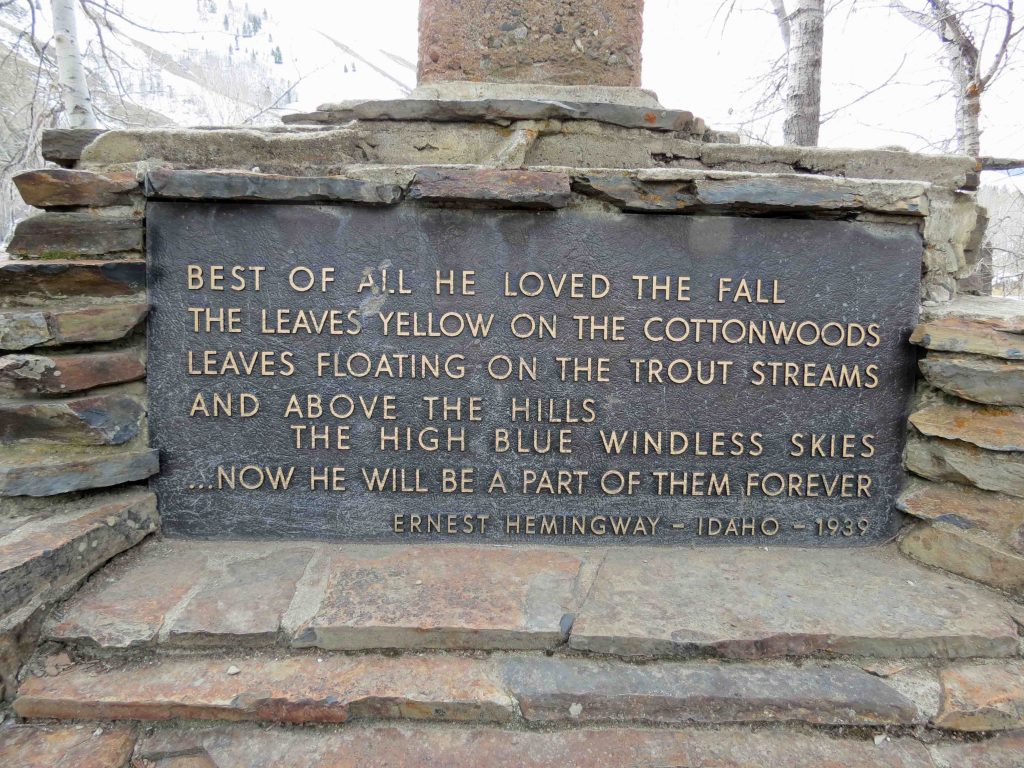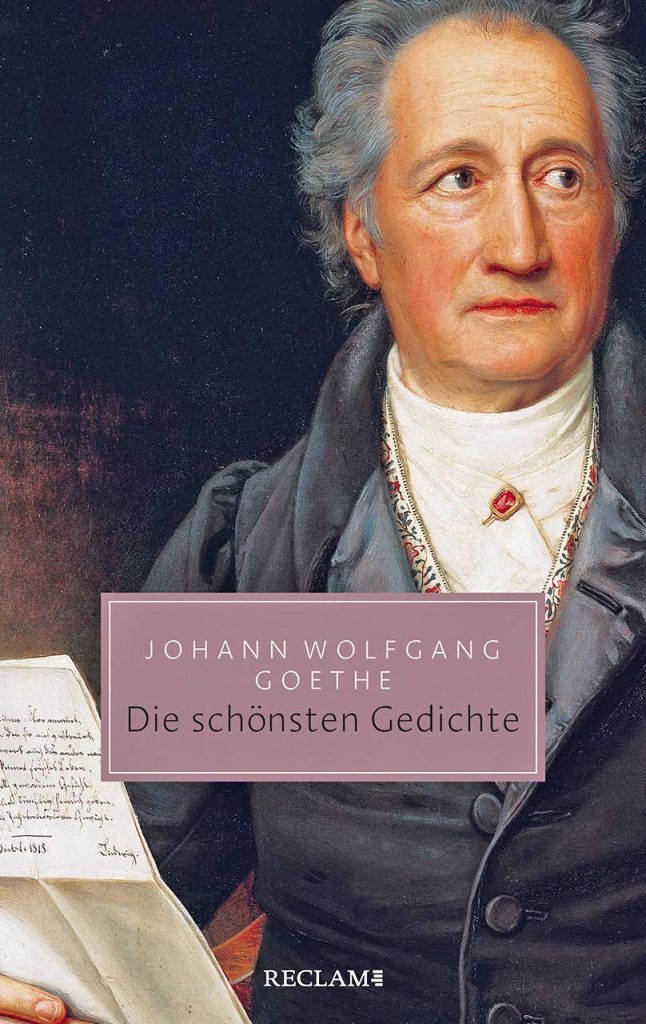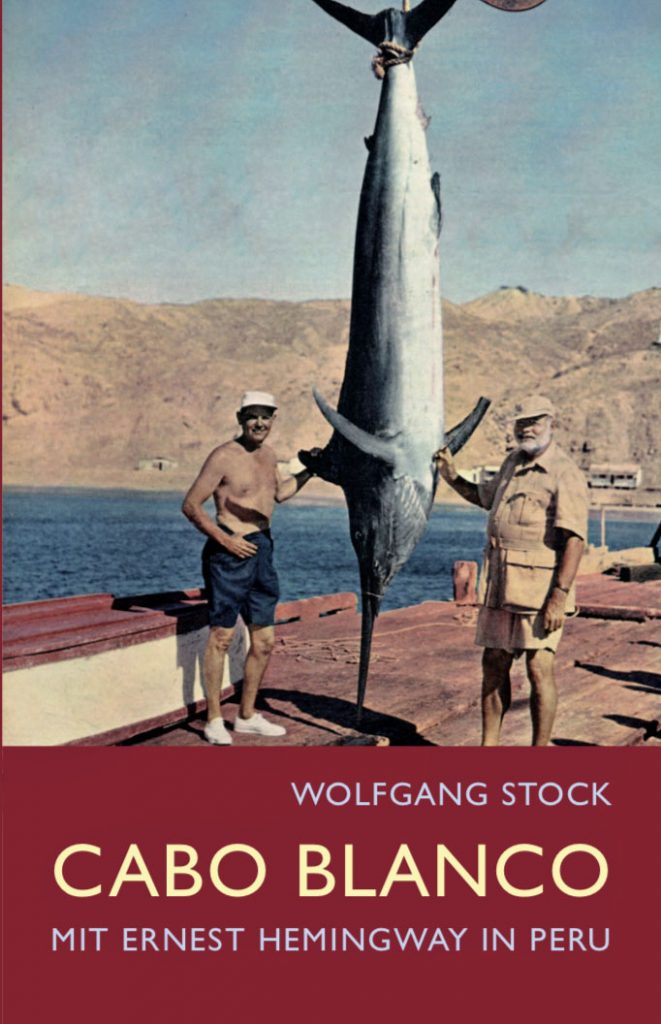Jacob Barnes, Robert Cohn und die Freunde Bill, Mike und die verführerische Lady Brett Ashley bringen in Hemingways Debutroman Fiesta ihre Probleme und Traumata mit in das Baskenland. Gefühlschaos, Seitensprünge, Alkoholismus und Obsessionen. Man nennt sie die Verlorene Generation, wegen des Werte-Dammbruchs, verursacht durch den Ersten Weltkrieg. Alle Ideale sind im Pulverdampf der Schützengräben verglüht, neue Ideen, eine Sichtweise, neue Inspirationen werden verzweifelt herbeigesehnt.
Die Truppe wird geerdet in Pamplona. Nicht unbedingt die Protagonisten der Erzählung, jedoch ihr Verfasser. Die Zeit scheint wie angehalten in Pamplona. Man feiert, trinkt und isst, so wie man auch vor dreihundert Jahren gefeiert und gegessen hat. Da hetzt man dem Neuen und Unbekannten hinterher, und merkt dann irgendwann, es ist das Bewährte und Althergebrachte, das für den inneren Frieden sorgt. Die Stille der Natur, die alten Gebräuche, die angestammten Umgangsformen und die traditionellen Speisen.
Ernest ist von Paris verwöhnt, doch die baskische Gastronomie ist in Qualität und Vielfalt nochmals ein Stück näher der Natur. Und Ernest schwärmt von den Meeresschnecken, den Tintenfische, den Garnelen, von den Jungfisch-Aalen nach Bilbao-Art, von den Koteletts mit Paprika, von den Sardellen und dem gebratenen Lachs mit Sauce Béarnaise, vom Thunfisch und dem Steinbutt.
Kulinarisch hält Euzkadi, wie die Region heute heißt, nicht hinter dem Berg. Seine baskischen Lieblingsgerichte erwähnt er in Wem die Stunde schlägt und in Der gefährliche Sommer. Der Amerikaner mag die deftige baskische Küche. Ein estofado de toro, den cordero en chilindrón, ein paar magras de jamón con tomate, es ist kulinarisch seine Welt. Stiergulasch, Lamm in Paprikaschoten, mageren Schinken mit Tomaten. Dazu stets den guten Wein aus Navarra.

Das Ajoarriero Estilo Iruña mit pochiertem Ei ist für den schnellen Hunger vor einer weinseligen Fiesta. Foto: W. Stock, April 2024.
In der ehemaligen Casa Marceliano in der Calle Mercado sind heute Behördenbüros untergebracht. Das Restaurant musste im Jahr 1993 die Pforten schließen, nun arbeiten hier Beamte der Stadtverwaltung. Früher war dies eine klassische Taverne, direkt rechts neben der Kirche Iglesia de los Padres Dominicos. Der Amerikaner hat hier gerne zu Mittag gegessen.
Nachdem Hemingway während der Sanfermines von 1926 dieses Lokal entdeckt hat, wird es sein Favorit. Manchmal wird bis in die Morgenstunden gefeiert. Im Jahr 1953 schreibt er: In Pamplona hatten wir unsere geheimen Orte wie die ‚Casa Marceliano‘, wohin wir nach dem ‚encierro‘ zum Essen, Trinken und Singen gingen. Das Holz der Tische und Treppen ist so sauber und geschrubbt wie das Deck oder Teakholz einer Yacht, mit dem Unterschied, dass die Tische schrecklich mit Wein bekleckert sind.
Seit seinem ersten Besuch in der Casa Marceliano schwärmt der Amerikaner vom Bacalao al Ajoarriero, einem typischen Gericht aus Navarra. Es wird zu seinem Lieblingsgericht. Ein entsalzter, in Stücke zerkleinerter Kabeljau in einem Sud aus Tomaten, Paprika, Knoblauch, Zwiebeln, Olivenöl und Petersilie. Dazu pochierte Eier. Der Bacalao al Ajoarriero ist ein volkstümliches Eintopf-artiges Schnellgericht, ideal als kleine Mahlzeit in einer Gruppe von Freunden oder in Familie.

Ein Himmelreich aus Vanille. Die Torrija im Café Iruña stellt so ziemlich jeden Nachtisch in den Schatten. Foto: W. Stock, April 2024.
Nun ist der herbe, fischige Geschmack nicht jedermanns Sache. Man muss danach die dominante Würze des Stockfisches gründlich löschen, mit rotem Hauswein aus Navarra beispielsweise, oder mit einer süßen Nachspeise aus der Region. Die Empfehlung kann hier lauten: Eine Torrija con helado de vainilla. Eine Tunkschnitte, ähnlich
![]()