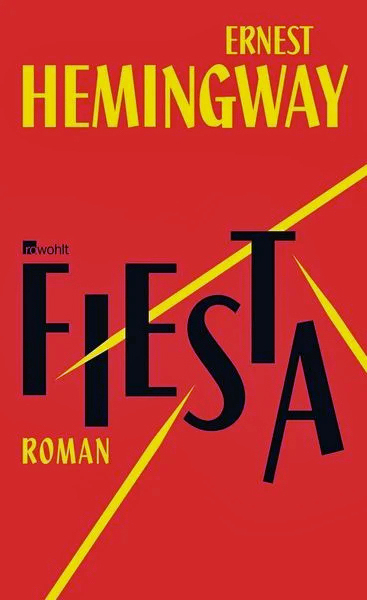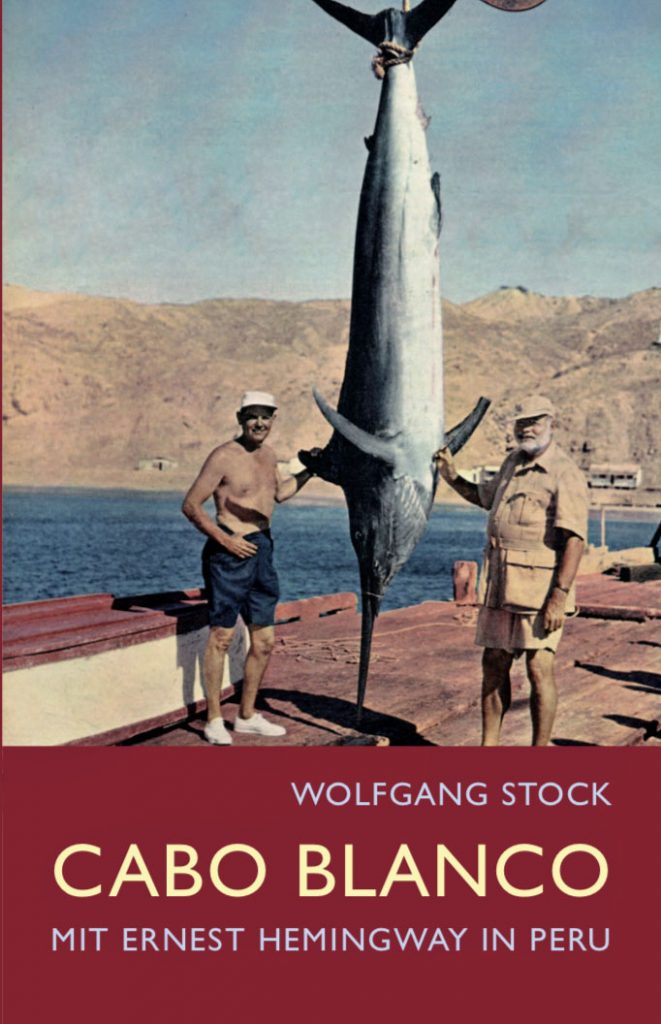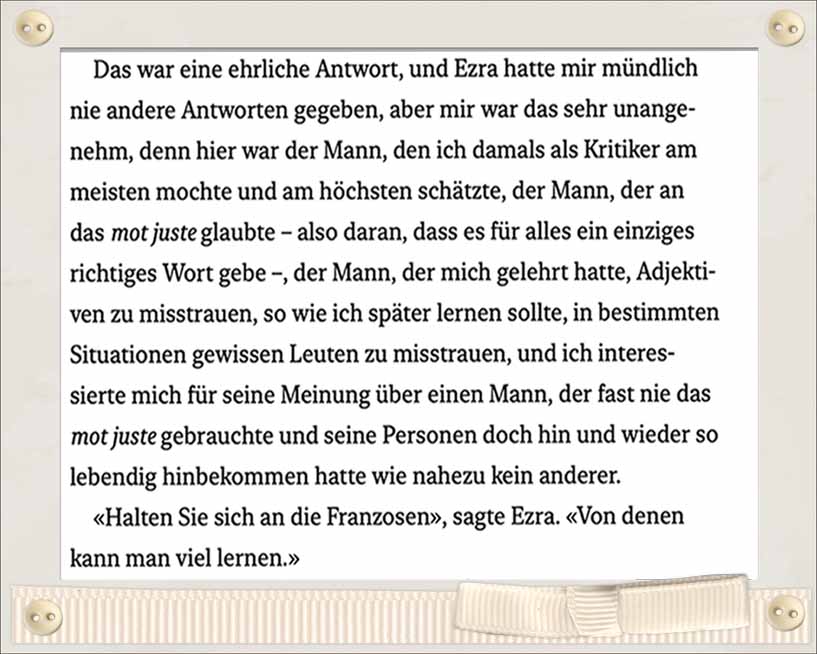
Manchmal sitzt er auf Finca Vigía an seinem Schreibtisch und das weiße Blatt bleibt leer. Ernest Hemingway kommt mitten im Satz nicht weiter, denn ein einzelnes Wort fehlt. Mitunter dauert die Blockade Stunden. Er quält sich einen ganzen Vormittag auf der Suche nach dem richtigen Wort. Nicht das zweitbeste Wort, nein, er will haarklein das einzig und allein passende Wort finden. Es ist das Nachspüren nach dem le mot juste.
Der US-Amerikaner hat diesen Begriff zum ersten Mal in Paris gehört, bei Gertrude Stein und den Kollegen, in den frühen 1920er Jahren. Das Konzept wird er fortan tief verinnerlichen: Das le mot juste zu finden, ist seitdem das heilige Bestreben dieses Schriftsteller. In dem autobiografischen Rückblick auf seine Lehrjahre in Europa, das Buch Paris – Ein Fest fürs Leben, hat Ernest diesem Ansatz im Dialog mit seinem Freund Ezra Pound einen Absatz gewidmet. Und er redet darüber in einem Bandwurmsatz, ganz unüblich für ihn.
Ezra hatte mir mündlich nie andere Antworten gegeben, aber mir war das sehr unangenehm, denn hier war der Mann, den ich damals als Kritiker am meisten mochte und am höchsten schätzte, der Mann, der an das mot juste glaubte – also daran, dass es für alles ein einziges richtiges Wort gebe –, der Mann, der mich gelehrt hatte, Adjektiven zu misstrauen, so wie ich später lernen sollte, in bestimmten Situationen gewissen Leuten zu misstrauen, und ich interessierte mich für seine Meinung über einen Mann, der fast nie das mot juste gebrauchte und seine Personen doch hin und wieder so lebendig hinbekommen hatte wie nahezu kein anderer. „Halten Sie sich an die Franzosen“, sagte Ezra. „Von denen kann man viel lernen.“
Von den Franzosen kann man eben le mot juste erlernen. Das richtige Wort. Dieser Grundgedanke ist noch heute ein oft genutztes Werkzeug im modernen Schreibhandwerk. Er umfasst den Ehrgeiz, das einzig wirklich passende Wort zu finden. Jenen präzisen Begriff, der ein Gefühl, eine Atmosphäre oder einen Gedanken exakt trifft. Ein Wort, das im Kontext, im Rhythmus und mit emotionaler Genauigkeit einen Sachverhalt auf den Punkt abbildet.
Dabei ist le mot juste weniger eine Technik als eine Haltung. Sich nie mit dem Zweitbesten zufriedenzugeben oder sich in Abschweifungen zu verfranzen. Es geht nicht darum, ausgefallen oder erhaben zu klingen. Le mot juste darf weder zu stark sein, noch zu schwach. Weder zu allgemein, noch zu poetisch überladen. Weder schön um jeden Preis, noch bewusst hässlich. Oft ist es ein ganz banales, alltägliches Wort – aber es sitzt da, wo alle anderen Wörter danebenliegen würden.
Der Ausdruck le mot juste wird mit Gustave Flaubert in Verbindung gebracht, Mitte des 19. Jahrhunderts prägt er dieses Ideal mit Blick auf die französische Poesie. Für jede Nuance und für jede Stimmung gibt es nur ein einziges Wort, das meisterhaft sitzt. Das Ziel dabei ist nicht nur inhaltliche Genauigkeit, sondern auch lyrische Tiefe. Flaubert sucht oft stundenlang nach dem einen perfekten Adjektiv. Hemingway hingegen richtet seine Aufmerksamkeit auf das vollkommene Substantiv und Verb. Er glaubt, dass Adjektive die Kraft eines Satzes schwächen.
Le Mot juste einfach als treffendes Wort zu übersetzen, wäre grundfalsch. Es meint eher das richtige Wort. Mehr noch. In dem Begriff juste versteckt sich das lateinische ius. Recht und Gesetz. Es geht vielmehr darum, das gerechte Wort zu finden. Ernest würde sagen das wahre Wort. In den Anfangsjahren ein begnadeter Autodidakt, sucht Hemingway die wahre Aussage mit fast wissenschaftlicher Akribie. So wie 3 mal 3 in der Multiplikation 9 ergibt – und eben nicht 8 oder 10 – so berechnet dieser Erzähler seine Prosa nach der Treffgenauigkeit mit dem richtigen Wort.
Am Ende von sieben Jahren in Paris hat Hemingway le mot juste nicht bloß kopiert – er hat es amerikanisiert, modernisiert und minimalistisch ausgelegt. Seine puristische Erzählkunst ist eigentlich immer auf der Suche nach dem le mot juste. Aber eben nicht französisch-elegant, sondern amerikanisch hart und knapp. Die Variante dieses Erzählers fällt kürzer und stiller aus als bei den Dichterfürsten aus Frankreich. Ernest zielt bewußt auf maximale Wirkung bei minimaler Sprache.
Der bärtige Autor begibt sich weniger auf die Suche nach dem poetisch perfekten Wort, sondern nach dem ehrlichsten Ausdruck. Oder nach dem Begriff, der am besten verschweigt. Seine scheinbar einfache Sprache – die jedoch extrem hart erarbeitet ist – sucht Dichte im Text. Mit eiserner Gründlichkeit, strenger Ökonomie und mit dem Wegfall der Botschaft. Wenn ein Wort erklärt, was die Handlung bereits aufzeigt, dann hat der Schreiber einen Riesenfehler gemacht.
Der Nobelpreisträger von 1954 radikalisiert vielmehr Präzision zur Genauigkeit durch Aussparung. Statt alles penibel zu erwähnen, benennt Hemingway nur das absolut Notwendige – dies erhöht abermals die Wichtigkeit in Bezug auf die Klarheit der Prosa. Bei Schreibblockaden sagt er zu sich selbst: Alles, was du tun musst, ist einen wahren Satz zu schreiben. Schreibe den wahrsten Satz, den du kennst.
Wenn der Satz wahr ist, dann muss auch jedes einzelne Wort wahr sein. Wort und Satz stehen in einem Spannungsverhältnis, beides muss unabdingbar wahr sein – sachlich, emotional und stilistisch. Ein wahrer Satz ist für Ernest Hemingway le mot juste in Satzform. Eine Aussage ohne dekorativen Ballast, die einen menschlichen Nerv direkt kitzelt.
Ein Beispiel des le mot juste finden wir in seinem Opus magnum Der alte Mann und das Meer gleich zu Beginn. Er war ein alter Mann, der allein… – der erste Halbsatz ist bereits von brutaler Einfachheit. Sieben Wörter und alles Wesentliche ist gesagt oder angedeutet: Alter, Passion, Einsamkeit, Tragik. Nicht ein überflüssiges Beiwort. Jedes Wort sitzt. Kein unnützes Adjektiv. Der Sprachrhythmus wirkt schlicht, fast biblisch.
Oder seine Kurzgeschichte Hügel wie weiße Elefanten aus dem Jahr 1927, auch hier direkt der Anfang: Die Hügel jenseits des Ebrotals waren lang und weiß. Auf den ersten Blick trivial. Beim zweiten Hinschauen genial. Le mot juste. Lange Hügel, nicht imposante Hügel. Länge, das ist neutral, kühl. Dann die Farbe. Weiß als Beschreibung für Schnee, trotzdem symbolisch offen. Weiß als Unschuld und Leere. Kein Gefühl und keine Bewertung schleichen sich in seinem Erzählstil. Und doch ahnt man, hier wird etwas verschwiegen, es braut sich etwas zusammen. Solche Rückschlüsse jedoch bleiben dem Leser überlassen.
Hemingways Suche nach dem wahren Wort revolutioniert die moderne Literatur. Er beweist, dass
![]()