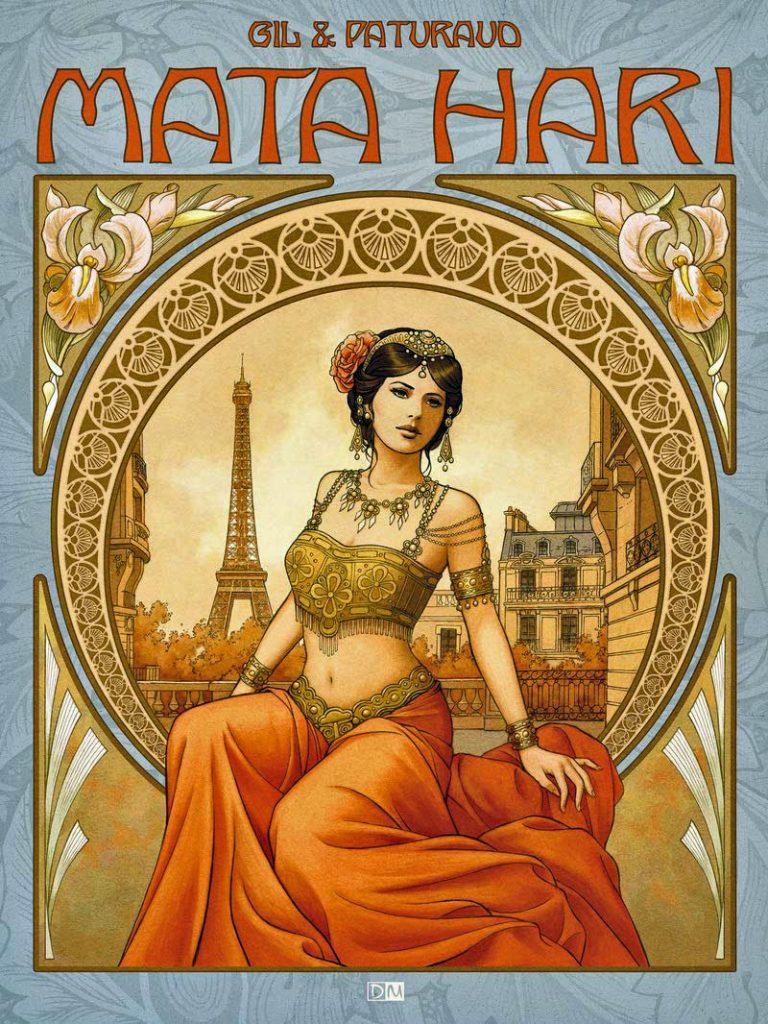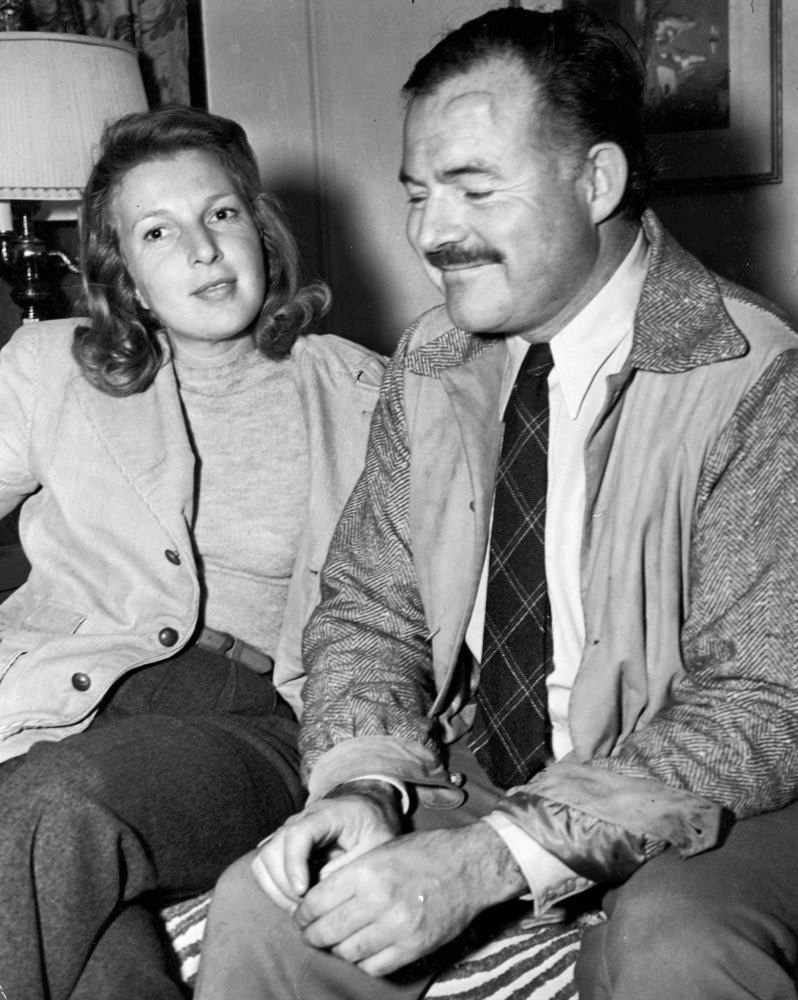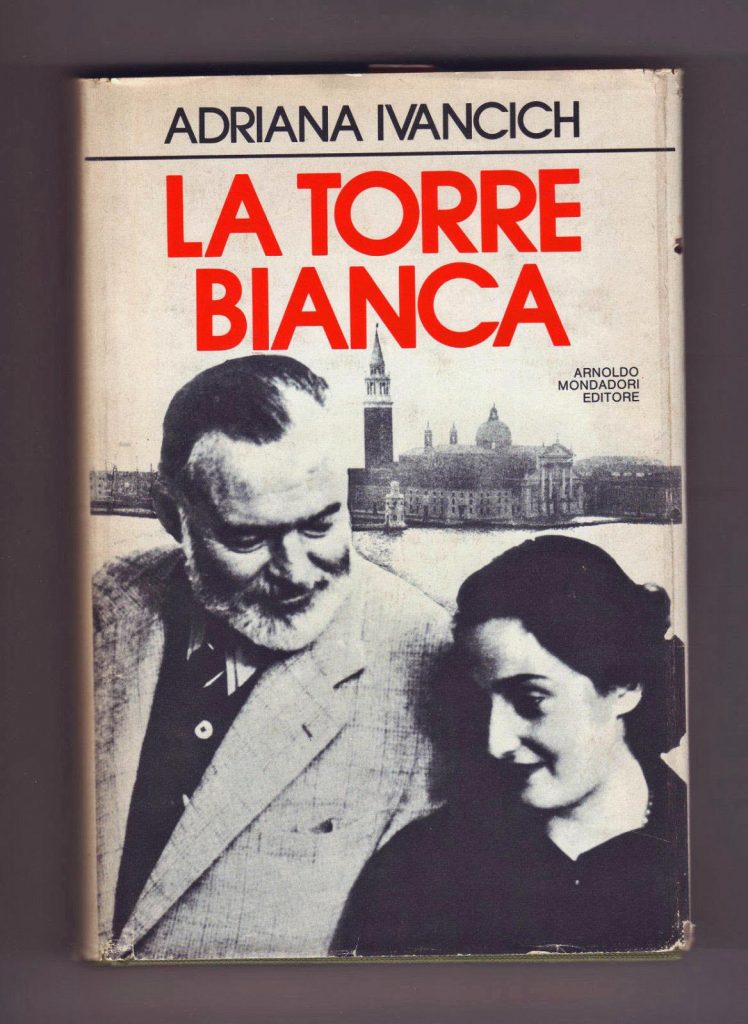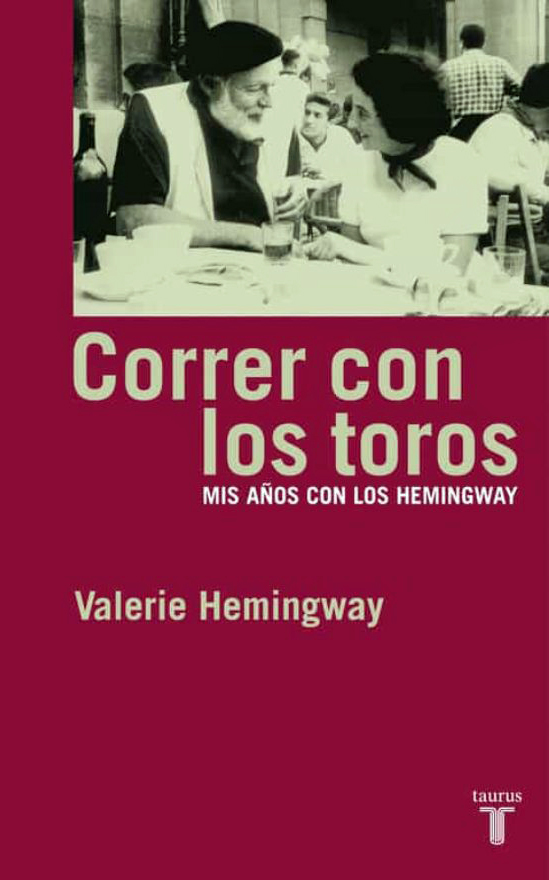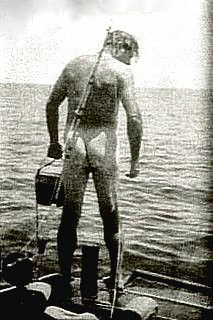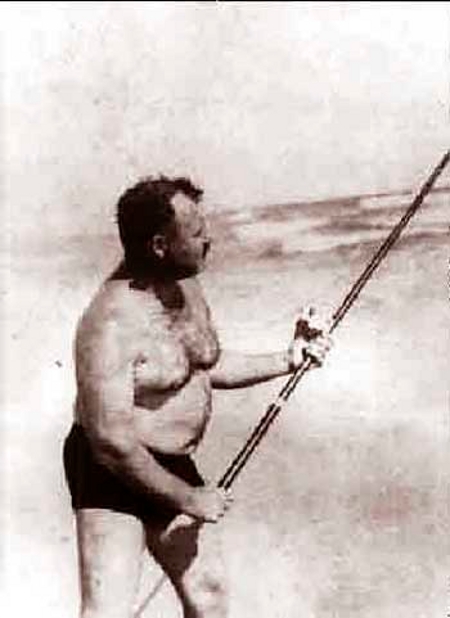Am 8. Juli 1918 entgeht der junge Ernest Hemingway an der italienisch-österreichischen Front bei Fossalta di Piave knapp dem Tod. Der 18-jährige Rotkreuz-Fahrer wird von einer österreichischen Granate getroffen, sein rechtes Bein liegt in Fetzen. In der Klinik des American Red Cross lernt der Verwundete dann seine erste große Liebe kennen. Sein Schwarm heißt Agnes von Kurowsky, eine US-Amerikanerin, väterlicherseits mit Wurzeln in Polen.
Ernest hat gerade sein erstes großes Abenteuer, die Schlacht gegen den Feind, hinter sich, mit den Schrapnellen einer Mörsergranate im Bein. Die adrette Agnes arbeitet als Krankenschwester im amerikanischen Rotkreuz-Hospital und kümmert sich um den vorlauten Teenager. Vom Krankenbett weg verliebt sich der junge Patient in die hochgewachsene Frau mit dem schönen kastanienfarbenen Haar.
Die mütterlich wirkende Agnes von Kurowsky ist sieben Jahre älter als Hemingway und kommt aus Washington D.C., wo sie in einer öffentlichen Bibliothek gearbeitet hat. Ernest ist hin und weg von der fürsorglichen Frau, er ist zum allerersten Mal in seinem Leben richtig verknallt, am liebsten würde er seine Agnes vom Fleck weg heiraten. Er offenbart sich und schreibt ihr feurige Liebesschwüre, die Angebetete erwidert die Gefühle und ist von dem stattlichen und gutaussehenden Burschen angetan.
Rasch kommt man sich näher und beide schmieden Pläne einer gemeinsamen Zukunft in den Vereinigten Staaten. Als es dem Patienten besser geht, unternehmen die Verliebten Ausflüge in die Umgebung. Die Stunden mit der liebevollen Frau erfüllen den jungen Mann von ganzem Herzen. Trotz seiner schlimmen Verletzung wirkt er ausgelassen und unbeschwert wie selten zuvor.
Monatelang wird Ernest im Mailänder Hospital gesund gepflegt. Ob es zwischen dem Patienten und der Krankenschwester zu mehr als nur zu harmlosen Umarmungen gekommen ist? Wahrscheinlich nicht. Solch ein Typ Mädchen bin ich nie gewesen, wird die attraktive Amerikanerin in späten Jahren verraten. Gleichwohl wird Ernest Hemingway vom Fortgang der Romanze im Innersten tief erschüttert.
Denn Agnes von Kurowsky beendet die Liebelei Knall auf Fall. Nach ein paar Wochen serviert die Angebetete den jungen Kerl trocken ab. „I am now & always will be too old, that’s the truth. I can’t get away from the fact that you’re just a boy – a kid.“ Du bist eigentlich noch ein Kind, jedenfalls bin ich zu alt für dich und werde immer zu alt für dich bleiben.
Kurz und knackig erhält der jugendliche Ernest einen Korb, von der ersten großen Liebe. Die fünf Monate dieser Beziehung werden Ernest Hemingway für den Rest seines Lebens begleiten, er wird diese Frau bis zum letzten Atemzug nicht vergessen. Agnes hat ungekannte Gefühle in ihm geweckt und sie konnte sein Herz erwärmen. Aber sie hat, schließlich und endlich, ihn auch bodenlos verletzt.
An seinen Wunden laboriert der hoch aufgeschossene Kerl auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Seine Kniescheibe ist ersetzt, er muss, längst zurück in der Heimat, monatelang auf Krücken laufen. In Oak Park erhält er eines Tages einen Brief von Agnes. Die Nachricht trifft ihn wie ein Schlag: Sie hat sich mit einem Offizier verbandelt, Tenente Domenico Caracciolo, der Italiener wird ihr neuer Liebhaber. Nach dem Lesen dieser Mitteilung überfällt ihn ein hohes Fieber und er verkriecht sich tagelang ins Bett.
In seinem Roman aus dem Jahr 1929 – A Farewell to Arms – verarbeitet Hemingway seine traumatischen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg. Leicht lassen sich für die Protagonisten reale Vorbilder erkennen: Frederic Henry – der Ich-Erzähler, ein amerikanischer Leutnant im Sanitätsdienst – erinnert an Ernest selbst. Catherine Barkley, die britische Krankenschwester und Henrys große Liebe, weist deutliche Parallelen zu Agnes von Kurowsky auf.
Über seine vier Ehen hinweg behält Ernest den Lebensweg von Agnes aufmerksam im Auge. Im Juli 1919 fährt
![]()