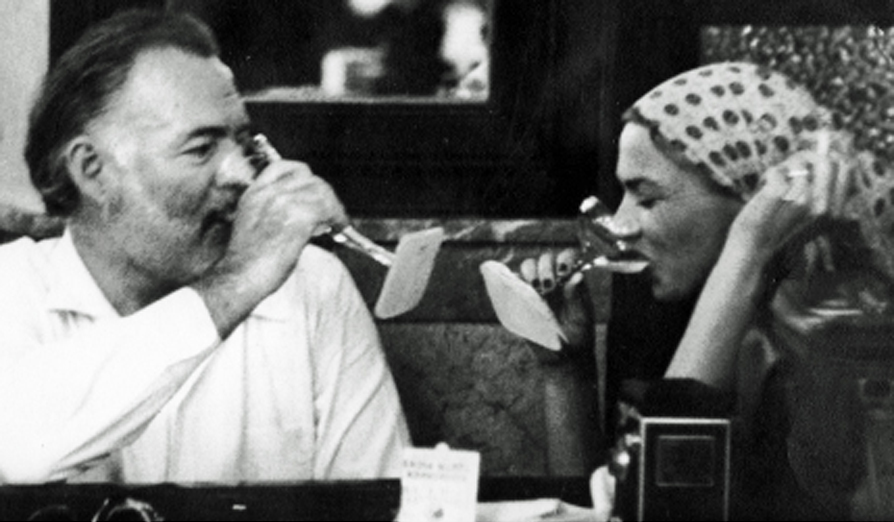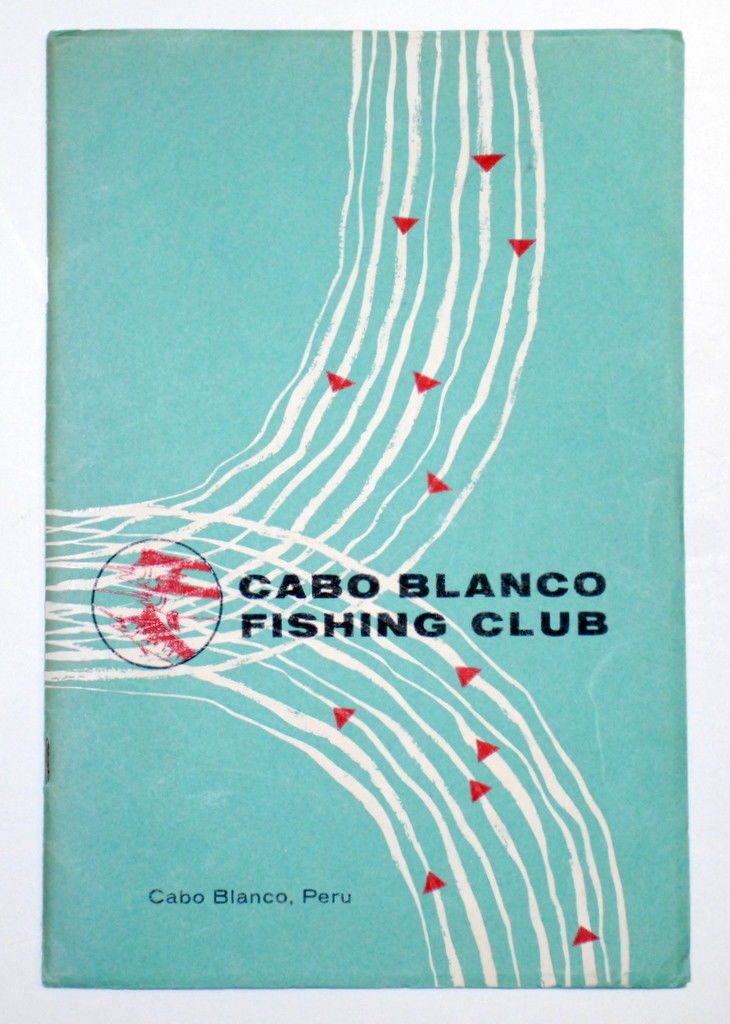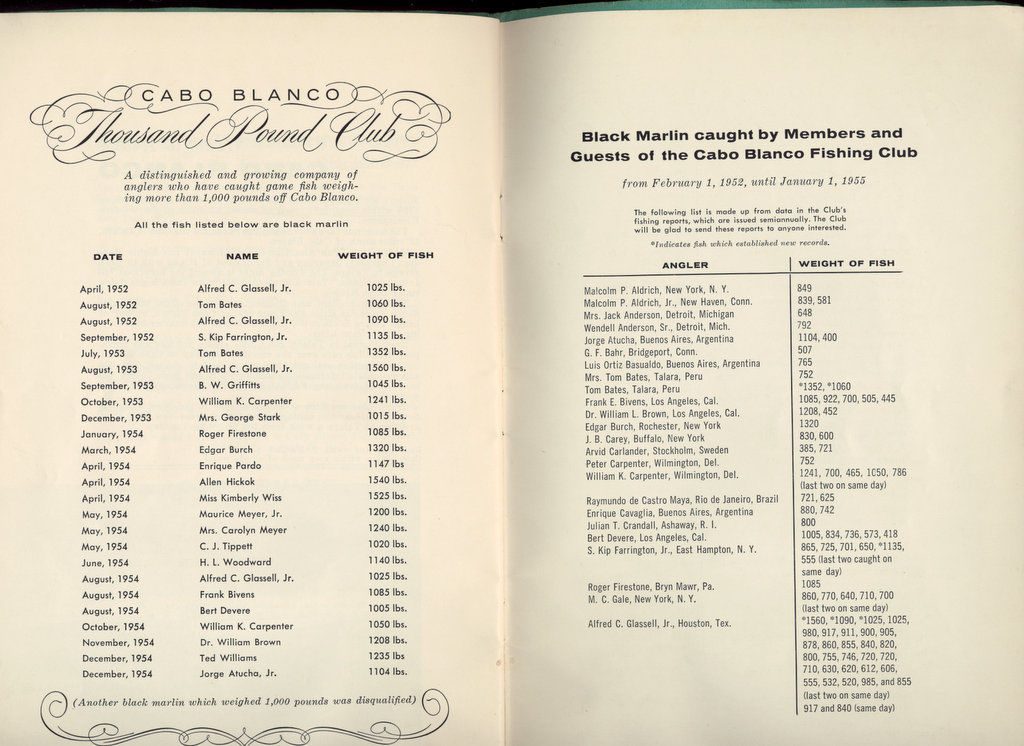Je länger Ernest Hemingway darüber nachsinnt, desto mehr muss er sich eingestehen, dass er ein ziemlich lausiger Familienvater ist. Seine drei Söhne, die er meist nur in den Sommerferien sieht, wachsen bei den Müttern in den USA auf. Er selbst hat sich sein Leben auf seiner kubanischen Finca Vigia bei Havanna, fernab von allem, kommod eingerichtet. Doch sein Daheim ist leer, weil nur er es ausfüllt.
Er hat es als Kind nicht anders erlebt. Ernest Miller Hemingway wird um acht Uhr morgens geboren, am 21. Juli 1899 in Oak Park, Illinois, einem Vorort von Chicago. Die Familie gehört zur oberen Mittelschicht, der Vater arbeitet als Mediziner, die Mutter ist Opernsängerin und Malerin. In der Familie herrscht die calvinistische Askese des Mittelwestens, nicht zuletzt im emotionalen Miteinander.
Die Mutter, Grace Hemingway, erweist sich als ein schlimmer Drache und schlägt die Kinder mit der Bürste. Den kleinen Ernest steckt sie jahrelang in Mädchenkleider und lässt seine Haare mädchenhaft lang wachsen. Ob’s gut gewesen ist, lernt man wahrscheinlich als Fallstudie im ersten Semester Psychoanalyse, Proseminar Trauma-Therapie.
Auch der Vater Clarence, ein Arzt, prügelt die Kinder und bestraft streng, aber in Wirklichkeit ist er ein Waschlappen. Doch den Vater verehrt der junge Ernest sehr. Er hat den Sohn früh in die Natur mitgenommen und ihm an den Bächen und Flüssen um den Lake Michigan das Fischen beigebracht. Die Hemingways besitzen das Sommerhaus Windemere am Walloon Lake im Norden Michigans und die Eltern verbringen dort mit den Kindern die Sommermonate.
Familie allerdings hat der junge Ernest Hemingway nicht gelernt, so wie man gut Schwimmen oder Autofahren lernen kann. Die Gefühlswelt im Elternhaus bleibt puritanisch kühl und auf das produktive Funktionieren ausgerichtet. Das Heim in Oak Park kann kein Vorbild für den jungen Ernest sein. Kaum achtzehn, da hat er sich schnell aus dem Staub gemacht. Nach Kansas, als Lokalreporter zum City Star, ein paar Monate später als Freiwilliger des Red Cross Ambulance Corps nach Italien, an die Front des Ersten Weltkriegs.
Noch als Erwachsener plagt den kernigen Schriftsteller ein Alptraum: Er träumt von
![]()